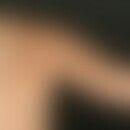Synonym(e)
Definition
Seltene, hochakute, IgE-vermittelte, Lichtdermatose mit, innerhalb von 5-10 Minuten nach Lichtexposition auftretender, Erythem- und Quaddelbildung an den exponierten Hautstellen.
Die Art und Schwere der Erkrankung ist abhängig von der Expositionsdauer, der Art der Sonnenbestrahlung, der Lokalisation und Ausdehnung der Sonnenlicht - exponierten Hautareale. Bekannt sind auch verzögerte Reaktionen von mehr als 1 Stunde nach Bestrahlung, verzögerte Rückbildung von > 24 h, sowie anaphylaktischen Reaktionen (bei Ganzkörperexposition) u.U. mit Beteiligung der Mundschleimhaut.
Auch interessant
Einteilung
Einige Autoren unterteilen die Lichturtikaria je nach auslösendem UV-Spekturm in 5 Gruppen:
- Typ I (UVB): 280-320nm
- Typ II(UVA): 320-400nm
- Typ III-Typ V : 400-800 nm
Vorkommen/Epidemiologie
0,08% der Urtikaria-Fälle. In Populationen mit dunkelhäutiger Bevölkerung wird diese Erkrankung nicht beobachtet.
Ätiopathogenese
IgE-vermittelte, allergische Reaktion vom Soforttyp auf ein unbekanntes, photoinduziertes Autoallergen; ein "Serumfaktor" spielt bei einigen Patienten eine Rolle. Anzunehmen ist dass einfallendes Licht durch ein Chromophor absorbiert wird. Dieses wird über eine Aktivierung zum Photoallergen gegen den sich ein IgE-Antikörper richtet. Der IgE-Antikörper ist auf der Oberfläche der Mastzelle platziert. Durch die Anlagerung des Photoallergens kommt es in der Folge zur Histaminfreisetzung und zur Quaddelbidlung.
Das Aktionsspektrum kann sich über den gesamten UV-Bereich erstrecken. Das Aktionsspektrum liegt jedoch bevorzugt im UVA-Wellenbereich und des sichtbaren Lichts (400-600nm). Seltener ist eine Auslösung durch UVB (280-320 nm) und Infrarot. Einige Patienten haben eine Urtikaria-Historie.
Manifestation
Meist bei jungen Erwachsenen (überwiegend 20.-40. Lebensjahr), selten im Greisenalter (7.-8. Lebensjahrzehnt) oder im Kleinkindalter (1.-6 LJ) auftretend.
Klinisches Bild
Innerhalb weniger Minunten nach Lichtexposition auftretende Erythem- und Quaddelbildung in den exponierten Arealen. Abklingen der Hauterscheinungen innerhalb von Minuten bis Stunden nach Beendigung der Exposition. Subjektiv leiden die Patienten unter extrem starkem Juckreiz. Bei ausgedehntem Befall mögliche Ausbildung von Schockfragmenten oder komplettem Schockzustand.
Fixe Lichturtikaria: Eine besondere Form der Lichturtikaria ist die fixe Lichturtikaria. Hierbei entstehen die Quaddeln nur in bestimmten Körperregionen. das übrige Integument bleibt auch nach Bestrahlung erscheinungsfrei.
Lichturtikaria vom verzögerten Typ: hierbei kommt es nicht wie üblich nach Minuten sondern erst nach Stunden zu einer urtikariellen Lokalreaktion.
Assoziierte Erkrankungen können sein:
- Polymorphe Lichtdermatose
- versch. Urtikariaformen (Wärme, Druck- Kälteurtikaria)
- Churg-Strauss-Syndrom
- Stevens-Johnson-Syndrom
- Hypereosinophile Dermatitis
Differentialdiagnose
Das klinische Bild mit der akuten Symptomatik, dem Nachweis von Quaddeln und dem eindeutigen solaren Verteilungsmuster ist diagnostisch.
Akute Urtikaria anderer Genese.
Bestrahlungstherapie
- Ein vorsichtiges Light-hardening kann versucht werden. Exakte Austestung des auslösenden Spektrums, danach Festlegung des individuell geeigneten Light-hardenings. Positive Effekte wurden mit systemischer PUVA-Therapie erzielt.
- Versuch der Schnellabhärtung mittels UVA1.
- Alternative zur PUVA-Therapie: Schmalband-UVB.
Interne Therapie
Antihistaminika in der üblichen Dosierung sind häufig nicht ausreichend. Höhere Dosierungen oder Kombinationen versch. Antihistaminka führen bei leichteren Fällen zum Erfolg.
Glukokortikoide +Antihistaminika: In der Initialphase symptombezogene Notfalltherapie wie bei akuter Urtikaria: ggf. hochdosiert systemische Glukokortikoide 100-150 mg Prednisolon-Äquivalent i.v. und Antihistaminika i.v. (z.B. Fenistil). Bei Schocksymptomatik Vorgehen entsprechend Schock, anaphylaktischer.
Alternativ: Chloroquin (Bemerkung: klinische Effekte sind wenig befriedigend)
Alternativ: Durch Plasmapherese kann insbesondere bei Patienten mit Serumfaktor eine auffallende Besserung des Befundes erzielt werden.
Alternativ Immunsuppressiva: In schweren Fällen können Immunsuppressiva (z.B. Ciclosporin A) versucht werden.
Alternativ IVIG : Besserung der Symptomatik wurde nach IVIG beschrieben.
Alternativ Omalizumab: Die Erfahrungen mit Omalizumab, einem IgE-Antikörper sind zunehmend positiv. Ein Heilversuch scheint bei Therapieresistenz gerechtfertigt (s. Allergo J Int (2016:16)
Verlauf/Prognose
Monate - bis jahrelanger Verlauf der Erkrankung mit eher lästigen als bedrohlichen Symptomen. Die Rückbildung kann spontan nach Monaten oder Jahren eintreten. In größeren Studien konnte innerhalb einer 10-Jahresfrist eine komplette Abheilung der Symptomatik bei 25% der Patienten nachgewiesen werden. Selten ist eine schwere Ausprägung der klinischen Symptomatik mit Schockzuständen.
Prophylaxe
Verordnung von Breitband- Lichtschutzmitteln mit entsprechend hohem Lichtschutzfaktor.
Dauergabe von Antihistaminika wie Desloratadin (z.B. Aerius) 1 Tbl./Tag oder Levocetirizin (z.B. Xusal) 1 Tbl./Tag.
Ggf. Versuch mit Chloroquin (z.B. Resochin) Initialdosis 250 mg/Tag p.o., später 2mal/Woche 250 mg p.o.
Tabellen
|
Testort |
Nicht lichtexponierte Hautpartien (z.B. Gesäß) |
|
Testfelder |
1,5 x 1,5 cm |
|
Strahlenquellen |
UV-A: Fluoreszenzstrahler (Philips TL09N, TL 10R) |
|
Metallhalogenidstrahler (340-400 nm) |
|
|
UV-B: Fluoreszenzstrahler (PHilips TL 12 285-350 nm) |
|
|
Sichtbares Licht: Diaprojektor (s.o.) |
|
|
Monochromator (in Praxen nicht vorhanden) |
|
|
Strahlendosen |
Meist niedrig, je nach anamnestischen Daten variieren! |
|
Ablesung |
Sofort, Beobachtung bis 1 Std. nach Exposition |
Hinweis(e)
Nachweis der Photodermatose:
- Photoprovokationstest an nicht sonnenexponierter Haut (Gesäß, Abdomen), da chronische Lichteinwirkung die Urtikariaschwelle erhöht. Entsprechend dem individuellen Aktionsspektrum werden oft bereits nach Durchführung der Lichttreppe mit UVA und UVB charakteristische Quaddeln ausgelöst. Bei einigen Patienten (in größeren Kollektiven sind dies rund 15%) kann auch durch sichtbares Licht (Diaprojektor) provoziert werden.
- > 90% der Patienten ist durch UVA provozierbar.
- Um das genaue Aktionsspektrum sowie die minimale Quaddeldosis ( MUD = minimale urtikarielle Dosis) zu bestimmen, sind zusätzliche Bestrahlungen möglichst 250-700 nm mit einem Monochromator sinnvoll (sie sind aber im klinischen Alltag nicht verfügbar).
- Alternativ kann auch eine vorsichtige (kontrollierte) Bestrahlung mit natürlichem Sonnenlicht durchgeführt werden.
- Die Ablesung der Testreaktionen erfolgt sofort und bis zu einer Stunde nach Bestrahlung.
- Serumfaktor-Test (spielt in der Praxis keine Rolle mehr): Entnahme von Patientenserum und Bestrahlung des Serums mit 0,1 J/cm2 UVB, 10 J/cm2 UVA oder mit sichtbarem Licht (je nach ermitteltem Aktionsspektrum) und anschließende intrakutane Injektion von 0,05-0,1 ml Serum und einer Kontrolle mit 0,05-0,1 ml 0,9% NaCl-Lsg. Nach 5 und 15 Minuten beurteilen, ob sich eine Quaddel an der Injektionsstelle bildet.
LiteraturFür Zugriff auf PubMed Studien mit nur einem Klick empfehlen wir  Kopernio
Kopernio
 Kopernio
Kopernio- Beattie PE et al. (2003) Characteristics and prognosis of idiopathic solar urticaria: a cohort of 87 cases. Arch Dermatol 139: 1149-1154
- Brüning JH (2016) Erfolgreiche Therapie der solaren Urtikaria mit Omalizumab. J Dtsch Dematol 14: 935-937
- Du-Thanh A et al. (2013) Solar urticaria: a time-extended retrospective series of 61 patients and review of literature. Eur J Dermatol 23:202-207
- Duschet P et al. (1989) Plasmapherese bei Lichturtikaria. Hautarzt 40: 553-555
- Goetze S et al. (2015) Lichturtikaria - Urticaria solaris. JDDG 13: 12501254
- Hochstadter EF et al. (2014) Solar urticaria in a 1-year-old infant:diagnosis and management. BMJ Case Rep 17 PubMed PMID: 24744064.
- Kowalzik L (2016) Omalizumab zur Trherapie der Lichturtikaria: noch vile offene Fragen. Allergo J Int 25: 16-17
- Leenutahong V et al. (1990) Solar urticaria: studies on mechanisms of tolerance. Br J Dermatol 122: 601-606
- Lim HW, Hönigsmann H, Hawk JLM (eds.) (2007) Photodermatology. Informa Healthcare USA, Inc. New York
- Merklen P (1904) Urticaire. La Pratique Dermatologique. Masson & Cie, Paris, S. 728-771
- Nakamura M et al. (2014) Comparison of photodermatoses in African-Americans and Caucasians: a follow-up study. Photodermatol Photoimmunol Photomed 30:231-236
- Roelandts R (2003) Diagnosis and treatment of solar urticaria. Dermatol Ther 16: 52-56
- Schwarz T (2004) Schnellabhärtung mit UVA1 - ein neues Therapieverfahren der Urticaria solaris. Akt Dermatol 30: 55-58
Verweisende Artikel (14)
Lichturtikaria, fixe; Light-hardening; MUD; Photoallergie (Übersicht); Polypodium leucotomos; Protoporphyria erythropoetica; Sommerurtikaria; Sonnenurtikaria; Urtica; Urticaria photogenica; ... Alle anzeigenWeiterführende Artikel (26)
Anaphylaktischer Schock; Antihistaminika, H2-Antagonisten; Antihistaminika, systemische; Chloroquin; Ciclosporin A; Desloratadin; Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis; Glukokortikosteroide; Hypereosinophile Dermatitis; IgE; ... Alle anzeigenDisclaimer
Bitte fragen Sie Ihren betreuenden Arzt, um eine endgültige und belastbare Diagnose zu erhalten. Diese Webseite kann Ihnen nur einen Anhaltspunkt liefern.